
Im Nachhinein sehe ich eine Bürde auf seinen Schultern und einen getrübten Blick. Ein mattes Grau auf seiner Haut. Im Nachhinein merke ich, dass ich sie gesehen habe. Sie geben keinen Anlass zur Sorge. Nicht in diesem Alltag, in dem ich mit ihm auf Distanz bin. In einer Atmosphäre von Achtsamkeit bleibe ich ahnungslos, denn die Sinne konzentrieren sich nicht auf ihn. Wie ich ist er ein Teil des Apparats. Freundlich, hilfsbereit, anders.
Im Nachhinein sehe ich seinen schweren Schritt. Eine Eigenheit, die ihn in den Gängen erkennbar macht. Das Gewicht ist nicht das seiner Gestalt. Mein Gehirn baut Geschichten. Es gibt für mich nichts zu erklären.
Der Andere ist immer unendlich anders als ich selbst. Die Annäherung an ihn wächst über meine Beobachtung. Er ist anwesend und wir verbringen gemeinsam Zeit in einem Raum. Im Raum sind Reden, Gesten und Geduld. Ein Austausch von kurzen Augenblicken. Im Raum sind viele Andere. Alle könnten diese dunklen Gedanken in sich tragen. Sie nehmen sie mit nach Hause und am nächsten Tag bringen sie sie wieder mit. Wenn sie wiederkommen.
Es ist keine spontane Entscheidung, nicht wiederzukommen. Sie baut sich auf. Sie beginnt mit einer Enttäuschung oder einer Entbehrung oder etwas ganz anderem. Sie führt auf einen Weg, der ständig bergab führt. Wie ein Tropfen, der durch winzige Steinritzen sickert. Das Wasser rinnt in kleine Tümpel, tiefer und tiefer. Manchmal quillt es als Quelle wieder ans Licht, manchmal verschwindet es für immer in der Tiefe. Verdampft. Vertrocknet. Verschwindet. Das Hinab ist nur ein Bild. Ein Bild, das leicht zu deuten ist. Vielleicht geht der Weg auch bergauf, immer höher, bis er endet und nur noch Wolken sind und eisige Luft. Auflösung im Nichts ist unten und oben. Dazwischen scheint es nichts zu geben, was hält. Auch ein Nichts. Kaum einer, der über dieses Nichts nicht schon nachgedacht hat. Manche glauben, nach dem Nichts kommt noch etwas. Die Ewigkeit. Ich glaube, die Ewigkeit ist immer, auch jetzt.
Im Nachhinein schenkt mir mein Gedächtnis ein paar Szenen des Zusammenseins. Eine Erinnerung reiht sich an die andere. An den Anderen, den ich nicht weiter kennen werde.


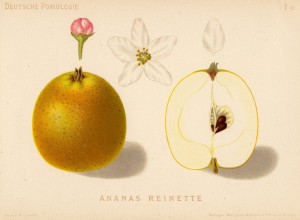

You must be logged in to post a comment.